Angehende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter benötigen in vielen Berufsfeldern der Sozialen Arbeit Handlungskompetenzen und Beratungskompetenzen, wie sie die soziale Absicherung ihrer Klientinnen und Klienten verbessern können. Dazu müssen die Studierenden mit dem Aufbau des Sozialgesetzbuchs vertraut gemacht werden.
Der zwanzigjährige alleinstehende Herr Pech ist nach einem Unfall im Haushalt dauerhaft erwerbsunfähig. Er hat weder Einkommen noch Vermögen. Welche Leistung steht ihm zur Sicherung seines Lebensunterhalts zu und an welche Behörde soll er sich deswegen wenden? Er soll ...
(A) Arbeitlosengeld steht nach § 136 SGB 3 nur Arbeitslosen zu. Und arbeitslos ist nach § 138 SGB 3 nur, wer für den Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Da Herr Pech dauerhaft erwerbsunfähig ist, steht er nicht für den Arbeitsmarkt zur Verfügung, ist nicht arbeitslos und hat keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.
(B) Unfallversicherungsleistungen kann nach dem SGB 7 beanspruchen, wer einen Arbeitsunfall hatte. Dazu gehören auch Wegeunfälle. Aber nicht Unfälle im eigenen Haushalt. Daher hat Herr Pech keinen Anspruch auf Unfallversicherungsleistungen.
(C) Ansprüche auf Bürgergeld stehen nach den §§ 7 und 8 SGB 2 nur erwerbsfähigen Personen zu. Herr Pech ist aber erwerbsunfähig. Deshalb steht ihm kein Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 zu.
Rentenversicherungsleistungen wie eine Erwerbsminderungsrente stehen Herrn Pech schon deshalb nicht zu, weil er die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren nicht erfüllt haben kann (§§ 43 und 50 SGB 6).
Antwort E trifft zu. Herr Pech sollte beim Sozialamt als dem örtlich zuständigen Sozialhilfeträger einen Antrag auf Hilfe wegen voller Erwerbsminderung stellen.
Für Behinderte richten sich die Versorgungsleistungen nach § 7 SGB 9 vorrangig nach den anderen Sozialgesetzbüchern. Herr Pech muss also zunächst seine Leistungsansprüche nach dem SGB 12 ausschöpfen und Hilfe für voll erwerbsgeminderte Personen nach den §§ 41 ff. SGB 12 beim Sozialamt beantragen.
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende und die Sozialhilfe sind wichtige Handlungsfelder sozialer Arbeit. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter müssen die für sie vorgesehenen Aufgaben bei der Arbeitsagentur, dem Jobcenter oder entsprechenden kommunalen Trägern wahrnehmen können. Insbesondere die Jugendämter, die Sozialämter und die Integrationsämter sind wichtige Arbeitgeber.
Welche Behörde ist für die Arbeitsvermittlung in erster Linie zuständig?
Nach den §§ 2 und 33 SGB 3 sind die Arbeitsagenturen für die Arbeitsvermittlung zuständig. Das gilt nach § 14 Absätze 2 und 3 SGB 2 auch für Leistungsbezieher nach dem SGB 2.
Die bei Behörden beschäftigten Sozialarbeiter müssen nach § 14 SGB 1 die Betroffenen beraten. Noch wichtiger ist die Beratung durch unabhängige Einrichtungen. Sie obliegt den dort beschäftigten Sozialarbeitern. Diese Beratung setzt Rechtskenntnisse und vor allem Methodenkenntnis vorraus.
Viele Fragen der Klienten werden die Sozialarbeiterinnen auch nicht beantworten können. Sie müssen sich also eigenständig in Rechtsgebiete neu einarbeiten können. Diese Einarbeitungsfähigkeit muss deshalb im Studium vermittelt werden.
Wichtig ist neben der Beratung in der Sache auch die Beratung über Kostenrisiken. Ist die Entscheidung über einen Widerspruch oder eine Klage gegen die vollständige oder teilweise Ablehnung einer Sozialleistung in der Regel kostenpflichtig?
A. Ja.
B. Nein.
C. Teilweise. Das gerichtliche Verfahren ist nach § 183 Satz 1 SGG kostenpflichtig, das Widerspruchsverfahren ist nach § 64 Absatz 1 SGB 10 kostenfrei.
Begründung: Nach den § 64 Absatz 1 SGB 10 und § 183 Satz 1 SGG und § 188 Satz 2 VwGO ist das Verfahren in der Regel kostenfrei.
5. Einarbeitungsfähigkeit
Es ist unmöglich, Studentinnen und Studenten in wenigen Stunden zu Experten auf allen Bereichen des Sozialrechts zu machen. Dies ist auch nicht notwendig. Aber Gesetzesstrukturen, Fachsprache und Entscheidungsabläufe müssen in dem Umfang vermittelt werden, der erforderlich ist, damit sie sich im Praktikum oder später im Beruf selbständig einarbeiten zu können. Dazu müssen sie in Gesetzen, Urteilen und Fachliteratur recherchieren können und die gefundenen Resultate auf ihre Probleme anwenden können.
In der beruflichen Praxis wird das Internet für die Recherche von Informationen immer wichtiger. Das gilt natürlich auch für den Bereich des Sozialrechts. Probieren Sie es aus:
Welche Behörde gewährt einen Vorschuss, wenn der Unterhaltspflichtige nicht mit dem Kind zusammenwohnt und er dem Kind nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt gewährt?
A. Das Sozialamt.
B. Das Jugendamt.
C. Die Familienkasse.
Begründung:
Der Fachbegriff für diese Sozialleistung heißt Unterhaltsvorschuss. Das zugrundeliegende Gesetz heißt Unterhaltsvorschussgesetz. Art. 62 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze bestimmt für Bayern, dass die Jugendämter für die Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes verantwortlich sind.
Eine Suchanfrage bei Google mit Zuständigkeit nach dem Unterhaltsvorschussgesetz würde sofort zu einem Treffer führen.
Das Internet enthält über das Sozialrecht sehr viele wertvolle Informationen. Neben kostenpflichtigen Datenbanken wie JURIS gibt es unzählige ausgezeichnete kostenfreie Angebote, sofern man Suchstrategien besitzt, um diese finden zu können.
Studierende bringen in der Regel gute Recherche-Kenntnisse für das Internet mit. Viele wissen, dass nur die Wortkombination aus den einschlägigen Fachbegriffen zu Treffern führen kann. Und in der Regel wissen die Studierenden auch schon, dass die Eingabe umgangssprachlicher Suchbegriffe zwar nicht unmittelbar zu Treffern führt, wohl aber oft zu den einschlägigen Fachbegriffen. Und dass diese gegoogelten Fachbegriffe dann wieder als Suchbegriffe verwendet werden können, um Treffer zu erhalten.
Studierenden wissen aber oft nicht, dass der Wahrheitsgehalt aller Quellen verifiziert werden muss und wie das genau funktioniert. Informationen auf Internetseiten zu sozialrechtlichen Fragen sind häufig deshalb falsch, weil sich das Sozialrecht sehr schnell ändert und Interseiten häufig nicht schnell genug aktualisiert werden.
Ordne die links stehenden Dokumente den rechtsstehenden Kategorien VERBINDLICH und UNVERBINDLICH zu. Berücksichtige dabei die Art des Textes und die Vertrauenswürdigkeit des Herausgebers.
Gesetze im Bundesgesetzblatt muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Broschüre über das Bürgergeld, herausgegeben vom Bundesministerium für Soziales muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Gesetze unter www.gesetze-im-internet muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Soziales muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Lehrbuch über Sozialhilferecht muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Gerichtsentscheidung aus einer juristischen Datenbank im Internet muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Informationen des Bundessozialministeriums über das Bürgergeld auf der offiziellen Homepage des Ministeriums muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Richtlinien, Erlasse und andere Verwaltungsvorschriften einer Bundesbehörde muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Im Internet unter der Homepage einer Landesregierung veröffentlichte Rechtsverordnung des Landes muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Das Internet enthält über das Sozialrecht sehr viele wertvolle Informationen. Neben kostenpflichtigen Datenbanken wie JURIS gibt es unzählige ausgezeichnete kostenfreie Angebote, sofern man Suchstrategien besitzt, um diese finden zu können.
Studierende bringen in der Regel gute Recherche-Kenntnisse für das Internet mit. Viele wissen, dass nur die Wortkombination aus den einschlägigen Fachbegriffen zu Treffern führen kann. Und in der Regel wissen die Studierenden auch schon, dass die Eingabe umgangssprachlicher Suchbegriffe zwar nicht unmittelbar zu Treffern führt, wohl aber oft zu den einschlägigen Fachbegriffen. Und dass diese gegoogelten Fachbegriffe dann wieder als Suchbegriffe verwendet werden können, um Treffer zu erhalten.
Studierenden wissen aber oft nicht, dass der Wahrheitsgehalt aller Quellen verifiziert werden muss und wie das genau funktioniert. Informationen auf Internetseiten zu sozialrechtlichen Fragen sind häufig deshalb falsch, weil sich das Sozialrecht sehr schnell ändert und Interseiten häufig nicht schnell genug aktualisiert werden.
Ordne die links stehenden Dokumente den rechtsstehenden Kategorien VERBINDLICH und UNVERBINDLICH zu. Berücksichtige dabei die Art des Textes und die Vertrauenswürdigkeit des Herausgebers.
Gesetze im Bundesgesetzblatt muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Broschüre über das Bürgergeld, herausgegeben vom Bundesministerium für Soziales muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Gesetze unter www.gesetze-im-internet muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Soziales muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Lehrbuch über Sozialhilferecht muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Gerichtsentscheidung aus einer juristischen Datenbank im Internet muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Informationen des Bundessozialministeriums über das Bürgergeld auf der offiziellen Homepage des Ministeriums muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Richtlinien, Erlasse und andere Verwaltungsvorschriften einer Bundesbehörde muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Im Internet unter der Homepage einer Landesregierung veröffentlichte Rechtsverordnung des Landes muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Das Internet enthält über das Sozialrecht sehr viele wertvolle Informationen. Neben kostenpflichtigen Datenbanken wie JURIS gibt es unzählige ausgezeichnete kostenfreie Angebote, sofern man Suchstrategien besitzt, um diese finden zu können.
Studierende bringen in der Regel gute Recherche-Kenntnisse für das Internet mit. Viele wissen, dass nur die Wortkombination aus den einschlägigen Fachbegriffen zu Treffern führen kann. Und in der Regel wissen die Studierenden auch schon, dass die Eingabe umgangssprachlicher Suchbegriffe zwar nicht unmittelbar zu Treffern führt, wohl aber oft zu den einschlägigen Fachbegriffen. Und dass diese gegoogelten Fachbegriffe dann wieder als Suchbegriffe verwendet werden können, um Treffer zu erhalten.
Studierenden wissen aber oft nicht, dass der Wahrheitsgehalt aller Quellen verifiziert werden muss und wie das genau funktioniert. Informationen auf Internetseiten zu sozialrechtlichen Fragen sind häufig deshalb falsch, weil sich das Sozialrecht sehr schnell ändert und Interseiten häufig nicht schnell genug aktualisiert werden.
Ordne die links stehenden Dokumente den rechtsstehenden Kategorien VERBINDLICH und UNVERBINDLICH zu (schwierig).
Gesetze im Bundesgesetzblatt muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Broschüre über das Bürgergeld, herausgegeben vom Bundesministerium für Soziales muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Gesetze unter www.gesetze-im-internet muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Soziales muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Lehrbuch über Sozialhilferecht muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Gerichtsentscheidung aus einer juristischen Datenbank im Internet muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Informationen des Bundessozialministeriums über das Bürgergeld auf der offiziellen Homepage des Ministeriums muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Richtlinien, Erlasse und andere Verwaltungsvorschriften einer Bundesbehörde muss zugeordnet werden zu Unverbindlich
Im Internet unter der Homepage einer Landesregierung veröffentlichte Rechtsverordnung des Landes muss zugeordnet werden zu Verbindlich
Zunächst ist zwischen Texten und Gesetzen zu unterscheiden. Gesetze sind verbindlich. Sie sind in der amtlichen Fassung im Internet unter www.gesetze-im-internet.de zu finden. Texte (Kommentare, Lehrbücher, Broschüren Aufsätze oder Internetseiten) geben nur die subjektive Meinung des Autors wieder. Texte sind nicht verbindlich. Und deshalb müssen die Aussagen in einem Text immer mit Hilfe der Gesetze auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden. Das Auffinden des Gesetzes und der einschlägigen Vorschrift darin erfordert die Kenntnis der Gesetzesstrukturen. Hat man die Norm gefunden, wird man sie nur verstehen, wenn man die Fachsprache der Gesetze versteht.
Wie überprüft man den Wahrheitsgehalt eines Textes aus dem Internet in rechtlicher Hinsicht?
Eine Sozialarbeiterin betreut eine ausländische Familie in Deutschland. Beide Eltern sind im Augenblick arbeitslos und haben zuvor noch kein volles Jahr in Deutschland gearbeitet. Sie wollen einen Antrag auf Bürgergeld stellen, können aber die sehr komplizierten Antragsformulare nicht ausfüllen. Sie verstehen die Fragen nicht und können auch die Antworten nicht selbst aufschreiben, weil sie die deutsche Sprache nicht in Schriftform beherrschen. Die Sozialarbeiterin versteht selbst auch einige Fragen in dem Formular nicht richtig. Welche Kompetenzen benötigt sie, um ihre Aufgabe zu erfüllen?
Sozialversicherungsleistungen
erhalten nur die ,Mitglieder einer Sozialversicherung,
und nur, wenn sie ausreichend Beiträge eingezahlt haben
und nur, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist
Versorgungsleistungen
erhalten nur Personen, die in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis zum Staat stehen,
wenn sie in eine Notlage geraten sind.
Fürsorgeleistungen
werden aus Steuermitteln finanziert,
dienen der Beseitigung einer Notlage,
die nicht durch Unterhaltsleistungen oder vorrangige Sozialleistungen abgewendet werden kann (Nachrang).
In Deutschland gibt es drei Säulen der sozialen Sicherung:
Sozialversicherungsleistungen, Versorgungsleistungen und Fürsorgeleistungen.
Zu welcher Säule der sozialen Sicherung gehört die Sozialhilfe nach dem SGB 12?
In Deutschland gibt es drei Arten von Sozialleistungen:
Sozialversicherungsleistungen, Versorgungsleistungen und Fürsorgeleistungen
Zu welcher Leistungsart gehört das Bürgergeld nach dem SGB 2?
In Deutschland gibt es drei Arten von Sozialleistungen:
Sozialversicherungsleistungen, Versorgungsleistungen und Fürsorgeleistungen
Zu welcher Leistungsart gehört das Arbeitslosengeld nach dem SGB 3?
In Betracht kommt ein Anspruch nach dem Bundesversorgungsgesetz, das die Versorgung von Soldaten bei Verletzungen in militärischen Einsätzen regelt (§ 1 BVG). Sozialversicherungsleistungen scheiden für den Soldaten aus, weil er im Gegensatz zu Arbeitnehmern nicht sozialversichert ist. Fürsorgeleistungen wie die Sozialhilfe nach dem SGB 2 oder SGB 12 scheiden nach § 5 Absatz 1 Satz 1 SGB 2 und § 2 SGB 12 ebenfalls aus, weil die speziellen Leistungen für Soldaten die Notlage bereits abwenden und vorrangig sind.
Es gibt mehrere Arten der Sozialversicherung. Nach der Reihenfolge ihrer Entstehung sind das:
Die Unfallversicherung (SGB 7).
Die Rentenversicherung (SGB 6).
Die Krankenversicherung (SGB 5).
Die Arbeitslosenversicherung (SGB 3).
Die Pflegeversicherung (SGB 11). Versuchen Sie sich zu merken, in welchem SGB welche Sozialversicherungsleistung geregelt ist!
Wie viele Arten der Sozialversicherung gibt es?
Es gibt fünf Arten der Sozialversicherung.
Zwischen der privaten Versicherung und der Sozialversicherung bestehen erhebliche Unterschiede:
Die Beitragshöhe hängt in der privaten Versicherung von der Höhe des Risikos ab (sog. Wagnisprinzip). In der Sozialversicherung ist die Beitragshöhe dagegen unabhängig vom Wagnis. Der Versicherte mit einem geringen Wagnis finanziert in der Sozialversicherung die Versicherung des Versicherten mit einem hohen Wagnis mit (sog. Solidarprinzip).
In der privaten Versicherung ist die Beitragshöhe unabhängig vom Einkommen des Versicherten. In der gesetzlichen Sozialversicherung hängt die Beitragshöhe dagegen von der Leistungsfähigkeit des Versicherungsnehmers ab (sog. Leistungsprinzip).
Daneben gibt es noch andere Unterschiede. So ist die private Versicherung in der Regel freiwillig. Eine Ausnahme ist insoweit die Kfz-Haftpflichtversicherung. Die Sozialversicherung ist dagegen in der Regel eine Pflichtversicherung. Aber auch hier gibt es einige wenige Ausnahmen.
Welcher Versicherte muss in welcher Versicherung mehr Krankenversicherungsbeitrag bezahlen? Welche Aussagen treffen zu?
Die Antworten B und C sind zutreffend. B trifft zu, weil in der privaten Versicherung für die Beitragshöhe nicht das Einkommen des Versicherten, sondern dessen Wagnis maßgebend ist. Und C trifft zu, weil in der gesetzlichen Sozialversicherung nach § 3 SGB 5 wegen des in § 1 SGB 5 verankerten Solidarprinzips nicht das Wagnis, sondern das Einkommen für die Beitragshöhe maßgebend ist.
Erklären Sie bitte die auf der linken Seite aufgelisteten Prinzipien für Versicherungen und entscheiden sie dann, ob diese in der Privatversicherung oder in der Sozialversicherung gelten, indem sie die links stehenden Prinzipien den rechts stehenden Kategorien per drag and drop zuordnen!
Freiwilligkeitsprinzip muss zugeordnet werden zu Privatversicherung
Pflichtmitgliedschaft muss zugeordnet werden zu Sozialversicherung
Wagnisprinziprinzip muss zugeordnet werden zu Privatversicherung
Solidarprinzip muss zugeordnet werden zu Sozialversicherung
Kapitaldeckungsprinzip muss zugeordnet werden zu Privatversicherung
Umlageverfahren muss zugeordnet werden zu Sozialversicherung
Die Sozialversicherung unterscheidet sich von der privaten Versicherung auch hinsichtlich der Finanzierung der Versicherungsleistungen.
In der privaten Versicherung wird aus den Beiträgen der Versicherten ein Vermögen angespart, aus welchem die Leistungen an die Versicherten erbracht werden (sog. Kapitaldeckungsverfahren).
In der gesetzlichen Sozialversicherung werden dagegen die laufenden Leistungen aus den laufenden Beiträgen bezahlt (sog. Umlageverfahren). Abgesehen von einer kleinen Schwankungsreserve gibt es keine Kapitaldeckung für die zu erbringenden Leistungen.
Was macht die Versicherung mit den Beiträgen? Welche Aussagen treffen zu?
Von welchen Faktoren hängt es in erster Linie ab, ob ein Sozialversicherungsträger Gewinne oder Verluste erwirtschaftet?
Die umlagefinanzierte gesetzliche Sozialversicherung bekommt Finanzierungsprobleme, wenn die Beitragsentwicklung nicht mit der Ausgabenentwicklung Schritt hält. In vier Bereichen der Sozialversicherung gibt es Finanzierungsprobleme, weil die Leistungen an die Versicherten stärker steigen, als Löhne und Sozialversicherungsbeiträge:
In der Rentenversicherung ist dies so, weil medizintechnische, medizinische und pharmazeutische Entwicklungen die Lebenserwartung erhöhen, dadurch die Rentenbezugszeiten verlängern und damit die Rentenleistungen erhöhen. Gleichzeitig verringert sich die Anzahl der Beitragszahler durch die Verringerung der Geburtenrate und die Zunahme von Minijobs.
In der Krankenversicherung bewirken dieselben Entwicklungen eine Kostenexplosion im Gesundheitswesen, während die Krankenversicherungsbeiträge aus den oben ausgeführten Gründen nicht in gleichem Umfang steigen.
In der Arbeitslosenversicherung führen Automatisierung und Digitalisierung dazu, dass die Arbeit von Menschen zunehmend von Robotern und Computern übernommen wird. Eine Zunahme von Arbeitslosigkeit führt zu Mehrausgaben der Arbeitslosenversicherung bei gleichzeitig sich verringernen Beitragseinnahmen.
In der Pflegeversicherung bewirkt die Veränderung der Arbeitswelt mehr Mobilität in der Gesellschaft. Großeltern wohnen oft nicht mehr in der Nähe von ihren Kindern und Enkeln und sind auf entgeltliche Pflege Dritter angewiesen.
Welche Sozialversicherung erwirtschaftet Überschüsse?
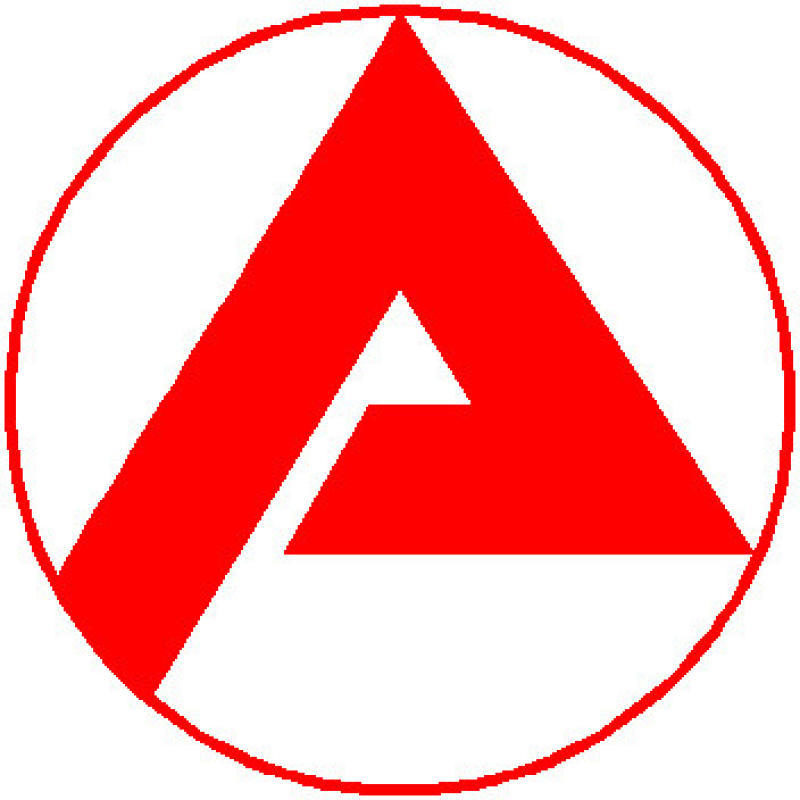 Arbeitslosengeld
ArbeitslosengeldDas Arbeitslosengeld unterscheidet sich grundlegend vom früheren Arbeitslosengeld 2, dem heutigen Bürgergeld.
Das Arbeitslosengeld ist in den §§ 136 ff. SGB 3 geregelt. Es handelt sich nach diesen Vorschriften um eine Sozialversicherungsleistung für Mitglieder der Arbeitslosenversicherung, welche Beiträge gezahlt und die Anwartschaftszeit erfüllt haben, wenn sie arbeitslos geworden sind (Versicherungsfall).
Das unterscheidet das Arbeitslosengeld nach dem SGB 3 vom Bürgergeld nach dem SGB 2. Nur Letzteres ist eine Fürsorgeleistung des Staates.
Plfegegeld nach dem SGB 11 muss zugeordnet werden zu Sozialversicherungsleistungen
Pensionsansprüche nach dem Beamtenversorgungsgesetz muss zugeordnet werden zu Versorgungsleistungen
Sozialhilfe nach dem SGB 12 muss zugeordnet werden zu Fürsorgeleistungen
Bürgergeld nach dem SGB 2 muss zugeordnet werden zu Fürsorgeleistungen
Arbeitslosengeld nach dem SGB 3 muss zugeordnet werden zu Sozialversicherungsleistungen
Wohngeld muss zugeordnet werden zu Fürsorgeleistungen
BAFöG muss zugeordnet werden zu Fürsorgeleistungen
Krankengeld nach dem SGB 5 muss zugeordnet werden zu Sozialversicherungsleistungen
Altersrente nach dem SGB 6 muss zugeordnet werden zu Sozialversicherungsleistungen
In Deutschland gibt es drei Säulen der sozialen Sicherung.
Und dementsprechend gibt es drei Arten von Sozialleistungen:
Sozialversicherungsleistungen
erhalten nur die ,Mitglieder einer Sozialversicherung,
und nur, wenn sie ausreichend Beiträge eingezahlt haben
und nur, wenn der Versicherungsfall eingetreten ist
Versorgungsleistungen
erhalten nur Personen, die in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis zum Staat stehen,
wenn sie in eine Notlage geraten sind.
Fürsorgeleistungen
werden aus Steuermitteln finanziert,
dienen der Beseitigung einer Notlage,
die nicht durch Unterhaltsleistungen oder vorrangige Sozialleistungen abgewendet werden kann (Nachrang).
Die Zuordnung der auf der linken Seite stehenden Sozialleistungen ergibt sich aus den oben stehenden Begriffsdefinitionen.
In welchem SGB ist die Krankenversicherung geregelt? Die Kankenversicherung ist im SGB
Pflegeversicherung muss zugeordnet werden zu SGB 11
Grundsicherung für Arbeitssuchende muss zugeordnet werden zu SGB 2
Verwaltungsverfahren für Sozialleistungsträger muss zugeordnet werden zu SGB 10
Krankenversicherung muss zugeordnet werden zu SGB 5
Unfallversicherung muss zugeordnet werden zu SGB 7
Kinder- und Jugendhilfe muss zugeordnet werden zu SGB 8
Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung muss zugeordnet werden zu SGB 3
Leistungsträger und allgemeine Regeln für die Gewährung von Sozialleistungen muss zugeordnet werden zu SGB 1
Sozialhilfe muss zugeordnet werden zu SGB 12
Nach § 23 SGB 2 bekommen Kinder unter 15 Jahren Bürgergeld für Nichterwerbsfähige, vorausgesetzt sie sind Teil einer Bedarfsgemeinschaft.
Dieser Anspruch geht nach § 5 Absatz 2 SGB 2 und § 2 SGB 12 dem Anspruch auf Sozialhilfe vor.
Schüler-BAföG steht Schülern an allgemeinbildenden Schulen nach § 12 BAFöG nur zu, wenn sie nicht mehr bei ihren Eltern wohnen.
Unterhaltsleistungen des Jugendamtes kommen nach § 39 SGB 8 ebenfalls nicht in Betracht, weil diese nur gewährt werden, wenn die Kinder oder Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht werden. Sie kommen nicht in Betracht, wenn die Kinder noch bei Ihren Eltern wohnen.
Nach § 7 Abs.1 Satz 2 SBG 2 erhält diese Personengruppe Leistungen nach dem Asylbewerberleisungsgesetz und keine nach dem SGB 2.